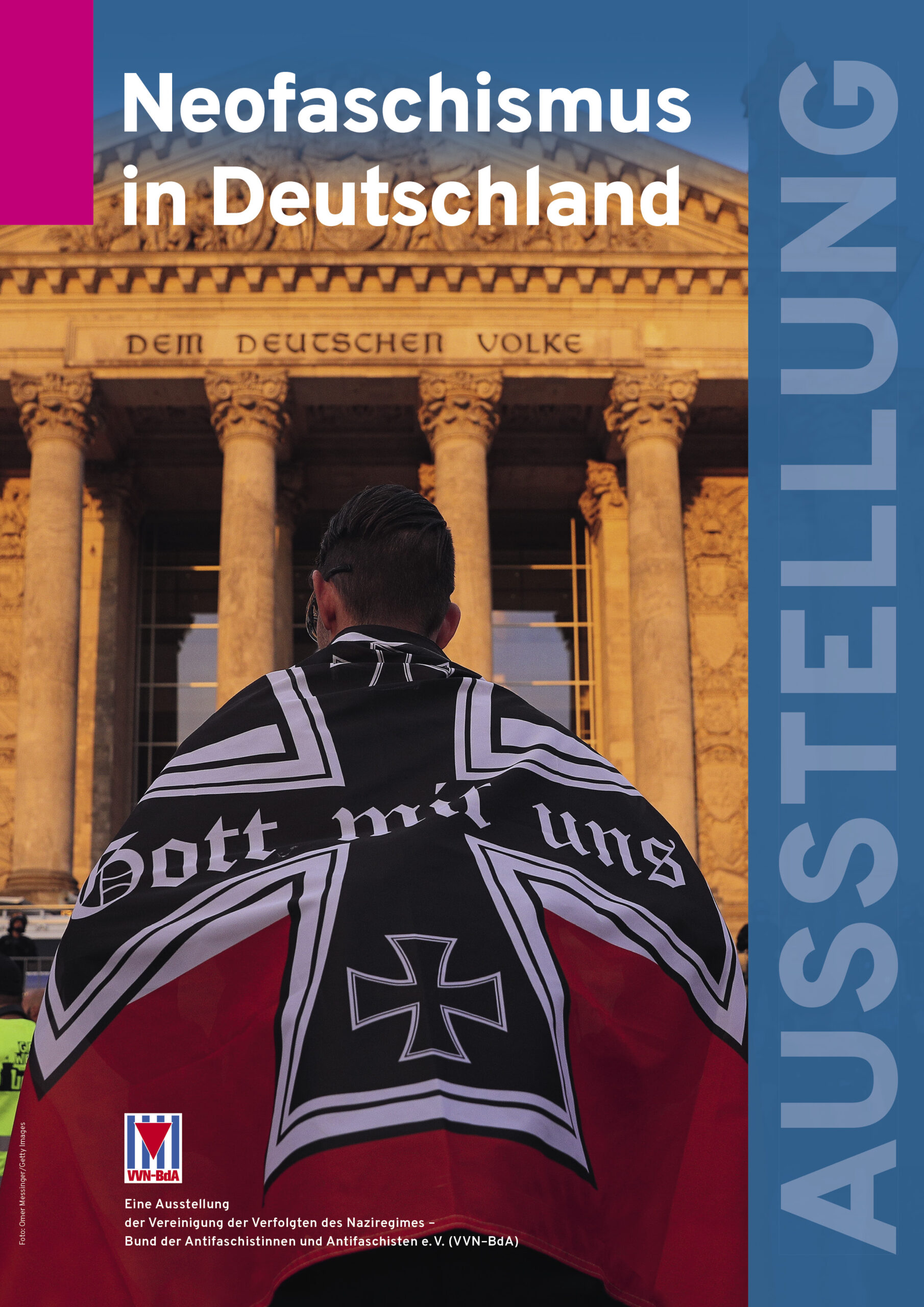Sonntag, 05. August, 10 Uhr ab Linkstreff West, Gröpelinger Heerstraße 120/Ecke Moorstraße Sommerausfahrt zur KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen Ausstellung Kinder im KZ. Wir wollen in Fahrgemeinschaften dorthin fahren. Interessierte melden sich bitte bei Raimund unter (0421) 6163215 oder 0176/4986 5184 (bitte Bescheid geben, ob PKW und Plätze für Mitf.).
Lesung Rolf Becker „Das kommunistische Manifest“
15. März 2018
Sonntag, 06.05. liest Rolf Becker um 19:30 Uhr in der Bremer Shakespeare Company anlässlich des 200. Geburtstages von Karl Marx den vollständigen Text des vor 170 Jahren erschienenen Kommunistischen Manifests (1848). In dieser mit Friedrich Engels verfassten, pünktlich zur Märzrevolution 1848 herausgebrachten Schrift wird in vielen Passagen eine Aktualität sichtbar, die den gegenwärtigen Kapitalismus im Stadium seiner umfassenden Globalisierung kennzeichnet. Über die historische Relevanz dieser Programmschrift hinaus wird die Veranstaltung dazu anregen, die welthistorische Bedeutung von Karl Marx als Gesellschaftswissenschaftler (politische Ökonomie, Philosophie, Geschichte, u.a.) zu reflektieren. In Kooperation mit dem DGB Bremen/Niedersachsen und der Rosa Luxemburg Initiative Bremen.
Gemeinsames Gedenken mit der Amicale Belge de Neuengamme
15. März 2018
Freitag, 04.05. gemeinsames Gedenken mit der Amicale Belge de Neuengamme 10:30 Uhr Bahrs Plate, anschließend Bunker, 12:30 Uhr Schützenhof
1.Mai
15. März 2018
Dienstag 1. Mai, Infostand Domshof, Aufstellung Osterdeich/Sielpfad, 12 Uhr Kundgebung Domshof
Erinnerung an Zwangsarbeit während des Nationalsozialismus in Bremen
15. März 2018
Montag, 23.04. 19 Uhr im Gemeindesaal der Ev. Gemeinde Gröpelingen-Oslebshausen, Danziger Straße, „Erinnerung an Zwangsarbeit während des Nationalsozialismus in Bremen“, Vortrag und Gespräch mit Studierenden der Universität Bremen über Forschungen zu Lagern und Arbeitsorten im Hafengebiet und Gespräche mit ehem. ZwangsarbeiterInnen und ihren Kindern in Kiew und Nikolajew über ihre Erfahrungen in Deutschland während des Krieges. Vorgestellt werden ein kurzer Film von zwei Jugendbegegnungen und neue Pläne für ein Erinnerungsprojekt am ehemaligen Außenlager Schützenhof. Dazu mehr im Blog https://bremkraine.hypotheses.org/
Ostermarsch
15. März 2018
Samstag, 31.03. Ostermarsch Alarmstufe Rot für den Planeten Erde, 11 Uhr Hauptbahnhof Auftaktkundgebung mit Dr. Lars Pohlmeier (IPPNW/ICAN) und Mizgin Ciftci (OHZ), 12 Uhr Kundgebung Marktplatz mit Doris Achelwilm, MdB (Die Linke), Arno Gottschalk, MdBB (SPD), Barbara Heller (Bremer Friedensforum) und Willy Schwarz (Kulturprogramm)
Die auch in diesem Jahr stattfindenden Ostermärsche der Friedensbewegung sollen ein Zeichen für „Abrüsten statt aufrüsten“ setzen, gegen die aktuellen Kriege und Konflikteskalation. Auch in Bremen wollen wir demonstrativ deutlich machen, dass die beabsichtigte Ausweitung des Kriegsgeschehens – und der deutschen Beteiligung daran – nicht unwidersprochen hingenommen wird. Die neue Regierung in Berlin sollte endlich die Friedensfrage aufgreifen und sich gegen Kriege und Waffenlieferungen für Frieden, Abrüstung und eine neue Entspannungspolitik einsetzen. Dafür sollen die Ostermärsche in diesem Jahr Druck machen.
Bremer Friedensforum
15. März 2018
Treffen Bremer Friedensforum: jeden ersten Donnerstag im Monat um 18:30 Uhr in der Villa Ichon, Goetheplatz 4
Jeden Donnerstag, 17 bis 18 Uhr, Mahnwache Bremer Friedensforum, Marktplatz
Jeden dritten Freitag im Monat, 12 bis 13 Uhr, Mahnwache gegen die Rüstungshochburg Bremen an der Domsheide (in Höhe von Hausnummer 8)
Jeden Freitag, 17 Uhr, Kundgebung der „Nordbremer Bürger gegen Krieg“, Bremen-Vegesack, Gerhard-Rohlfs-Straße/Breite Straße
Weitere Termine aus der Friedensbewegung: http://www.friedenskooperative.de/termine.htm
Streik gegen den Krieg
15. März 2018
Deutlich mehr Zulauf als im letzten Jahr hatte die Gedenkveranstaltung am 04. Februar auf dem Waller Friedhof. Sonnenschein sorgte für vergleichsweise milde Temperaturen, der Schneefall am frühen Morgen gab der Veranstaltung eine vertraute Kulisse. Buchtstraßenchor und Rotes Krokodil durchzogen die im besten Sinne historische Unterrichtsstunde. In der Eröffnung wurde darauf hingewiesen, dass die sich anbahnende Fortsetzung der sozialen Kahlschlagpolitik in diesem Land nicht unwidersprochen bleibt…
Achim Bigus, Vertrauenskörperleiter der IG Metall bei VW Osnabrück, legte den Schwerpunkt seiner Ausführungen auf den großen Metallarbeiterstreik im Januar 1918. Ausgehend von den großen Berliner Rüstungsbetrieben streikten die Metallarbeiter gegen den Großen Krieg. Verbunden waren die Aufrufe nach einer Verbesserung der materiellen Lage über die Kriegsjahre mit antimilitaristischen Anliegen und dem Aufruf, die führenden Köpfe der organisierten Arbeiterschaft aus der Haft freizulassen…
Im Westend brillierte Aline Barthélémy anschließend mit einem sehr guten Programm aus Arbeiter- und Widerstandsliedern vor einer vergleichsweise großen und leider sehr undisziplinierten Zuhörerschaft, die wohl eher leichte Unterhaltungsmusik bei Kaffee, Tee und Kuchenbergen erhofft hatte.
Auszug BAF 04.-05.2018
Menschenhandel Budapest 1944
15. März 2018
Zwei Dutzend Interessierte sahen am 11. Februar im Kino City46 den Film „Lebende Ware“, der die verbrecherische Übernahme und Ausplünderung des Schwerindustriekonzerns der Budapester Jüdischen Familie Weiss durch den SS-Obersturmführer und späteren Bremer Getreidegroßhändler Kurt A. Becher zeigte.
Lebende Ware ist ein Film über einen Menschenhandel 1944, kurz bevor die Rote Armee die ungarische Grenze erreichte. Nach Besetzung des Landes im März 1944 kontrollierte die SS Wirtschaft und Verkehr des Landes. Nach einem Militärputsch etablierte sich eine willfährige Satellitenregierung. Der Obersturmbannführer Kurt Andreas Ernst Becher wurde zum außerordentlichen Vertrauensmann Himmlers in Budapest. Er geriet mehr und mehr in Konflikt mit Adolf Eichmann, der die vollständige Deportation der ungarischen Juden ins Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau betrieb. Himmler aber brauchte jüdische Geiseln als Verhandlungsmasse für ein Separatabkommen mit den Westalliierten…
Auszug BAF 04.-05.2018
Lebhafte Diskussion fundierter Rechercheberichte
15. März 2018
Zwei Dutzend TeilnehmerInnen diskutierten lebhaft auf der diesjährigen Nordkonferenz in Heideruh die beiden vorgestellten Berichte zu Rechtsentwicklung Aufrüstungsprogramm. Heideruh selbst stand im Zentrum der Bestandaufnahme unserer Bildungsarbeit. In ihrer Begrüßung erläuterte Bea Trampenau die Situation der Antifaschistischen Bildungs- und Begegnungsstätte. Auf dem Weg zum 60. Gründungstag zwei Wochen später wurde allen noch einmal die Verantwortung um den Erhalt des Diskussionsmittelpunkts deutlich…
Andrea Röpke stellte ihr zweites aufwändig recherchiertes Jahrbuch zur Entwicklung rechter Gewalt vor. Erschreckend ist das erneute Anwachsen von Tötungsdelikten gegenüber Migranten, 2.119 Angriffe alleine 2016/17. Festzustellen sind 92 rechte Terrorgruppen, manche vom Verfassungsschutz gar nicht erfasst…
Lühr Henken erläuterte faktenreich gespickt das Aufrüstungsprogramm von Nato und EU und erläuterte die Aufrüstungsschritte und Strategieveränderungen seit 1992. Er las dazu Passagen aus aktuellen Einschätzungen zum Weißbuch der Bundeswehr. Der Umbau der Bundeswehr folgt strategischen Veränderungen durch die Bundesregierung. Der langfristige Einsatz in 14 Ländern und die Festlegung auf Erhöhung des Budgets in Richtung auf 2% des BIP binnen zehn Jahren verlangt eine Erhöhung der Truppenzahl und eine erhebliche Erweiterung der Ressourcen. Das wären 80 Milliarden Euro jährlich…
Mit einer Bildpräsentation wurden in Gesprächen Anliegen, Schwerpunkte und Zusammensetzung in 25 Jahren Nordkonferenz rückblickend betrachtet. Die Bedeutung Heideruhs als Kristallisationspunkt der Bildungsarbeit wurde hervorgehoben die langjährigen Mitstreiter in Vorträgen und Diskussionen vorgestellt. Musikalischen Abschluss bildete ein etwas schrilles Konzert der Gruppe Sokugayu mit Texten von Erich Mühsam und Klezmer.
Auszug BAF 04.-05.2018